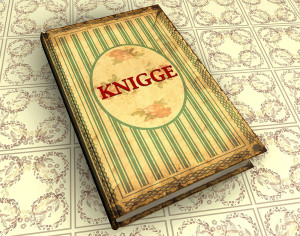5. Körperliche Fitness: Wer sich körperlich fit fühlt, hat es leichter, dem Denken Beine zu machen

Menschen waren «Bewegungstiere». Deshalb sind sie so gebaut, wie sie es eben sind. Überleben hiess: Bewegung – jagen, arbeiten und schneller rennen als der Säbelzahntiger. Das war einmal. Die Menschen sind zu «Sitztieren» verkommen. Mehr als die Hälfte ihrer Zeit verbringen Erwachsene heutzutage auf dem Hintern. Im Durchschnitt. Der gesellschaftliche Wandel hat die Menschen buchstäblich von den Beinen geholt. Und jetzt sind sie – auch buchstäblich – am Arsch. Denn die sitzende Lebensweise bringt den Körper arg in die Bredouille. Er ist nicht konstruiert für dauerguckende Dauersitzer.
Bewegung ergibt sich nicht mehr aus dem Leben heraus. Bewegung muss man künstlich erzeugen. Man muss sich bewegen, um sich zu bewegen. Oder anders gesagt: Das Leben offeriert die Bequemlichkeit. Um es unbequem haben zu können, muss man sich anstrengen.
Und das in einer Überflussgesellschaft, die dazu animiert, es sich gut gehen zu lassen. Doch: «Es sich gut gehen lassen» ist meist und auf Dauer das Gegenteil von «gut». Denn es verbindet sich in aller Regel mit Konsum und Bequemlichkeit – und einem grosszügigen Negieren der mahnenden inneren Stimmen.
Doch wer sich selbst gegenüber zu viel Nachsicht übt, macht sich das Leben schwer – wiederum im wahrsten Sinne des Wortes. Der Blick in die Gesellschaft macht augenfällig: Die Kleidergrössen nehmen in dem Ausmass zu, wie die körperliche Fitness abnimmt. Die Menschen erlahmen und mit ihnen ihr Stoffwechsel. Entsprechend steigen die Krankheitsrisiken.
Sitzen ist das neue Rauchen. Die fehlende Bewegung gefährdet die Gesundheit. Im Gegensatz zu den Zigarettenpckungen sind die Sitzflächen der Stühle noch nicht mit warnenden Aufklebern versehen worden. Und im Gegensatz zum Rauchen schützt man die Heranwachsenden nicht vor übermässigem Sitzen. Im Gegenteil. Heutige Kinder spielen lieber drin bei den Steckdosen. Und man lässt sie. Oder fördert es sogar. Nicht von ungefähr spricht man von «Shut-up-Toys» – gucken, sitzen, Klappe halten. Das ist bequem. Für alle. Das Doofe daran: Es führt zu Entzugserscheinungen – beim Entzug von Bequemlichkeit.
Physisches Wohlbefinden ist nicht gleichzusetzen mit sportlicher Entbehrung oder schweisstreibender Höchstleistung. Das darf zwar duchaus auch sein. Indes: Die Devise «schonen schadet» bezieht sich nicht auf die Extreme. Viel wichtiger ist Regelmässigkeit. Viele kleine Bewegungen – mindestens eine Stunde pro Tag sagt die WHO – bringen mehr als ein Waldlauf pro Woche. James A. Levine, Professor an der Mayo-Klinik in Arizona, fasst seine Forschungen unter dem Begriff «NEAT» zusammen – Non Exercise Activity Thermogenesis. Und er meint damit all die vielen kleinen und grösseren Bewegungen, die sich aus dem Alltag ergeben – wenn man sie nutzt.
Sich immer wieder erheben, stehen statt sitzen, die Treppe nehmen statt den Lift, das macht Gesundheit zu einer Haltung. Es ist eine Haltung, die sich nicht darauf beschränkt, Bewegungsmöglichkeiten aktiv und selbstverständlich zu nutzen. Es ist eine Haltung, eine Charaktereigenschaft, die sich ebenso zeigt im Ess- und Schlafverhalten, die sich zeigt im Umgang mit digitalen Medien und anderen Suchtmitteln, die sich zeigt in schulischen und anderen Herausforderungen. Kurz: Die sich zeigt im Aufbau guter Gewohnheiten.
Gegen zwei Drittel dessen, was wir täglich tun oder lassen, ist von Gewohnheiten gesteuert. Die gleichen guten Gewohnheiten, die uns veranlassen, den Fernseher auszuschalten, das Handy zur Seite zu legen, die Treppe zu nehmen, veranlassen uns auch, nicht gleich mit der erstbesten Lösung zufrieden zu sein, die Aufgabe von einer anderen Seite anzugehen, wenn es nicht auf Anhieb klappen will.
Schulisches Lernen ist mitunter anstrengend. Dinge verstehen wollen, das braucht einen vifen Geist. Es braucht die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich anzustrengen, beharrlich zu sein, durchzuhalten, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und das alles in einer entkrampften, entspannten Manier. Das gelingt dann besser, wenn man ein gutes Gefühl hat mit sich. Dabei spielt der Körper eine wichtige Rolle.
Der Erfolg mag Menschen, die sich anstrengen. Solche Menschen treten entsprechend in die Welt, gehen unverkrampfter und zuversichtlicher an Herausforderungen heran. Das ist gut und tut gut – auch in der Schule. Denn wer sich körperlich fit fühlt, dem fällt es auch leichter, dem Denken Beine zu machen.
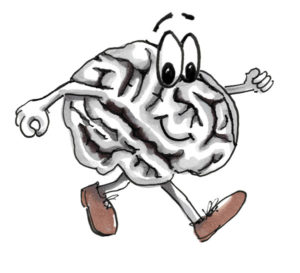

 Und selbst für den Weg ins nächste Stockwerk wartet man lieber auf den Lift. Man könnte meinen, die Gesellschaft spiele Mikado: Wer sich bewegt, der hat verloren.
Und selbst für den Weg ins nächste Stockwerk wartet man lieber auf den Lift. Man könnte meinen, die Gesellschaft spiele Mikado: Wer sich bewegt, der hat verloren.