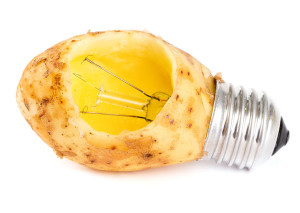Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen

Der personelle Stabilitätsfaktor in den Schulen sind die Schüler. Klar. Sie sind am längsten anwesend. Bei den Lehrpersonen dagegen herrscht ein dauerndes Kommen und Gehen. Mehr als zwei Drittel arbeiten Teilzeit, häufig in kleinen Pensen. Viele schöpfen aus genau dieser Quelle ihre berufliche Motivation. In entsprechend atomisierten Teilmengen sind die Verantwortlichkeiten organisiert – inhaltlich, zeitlich und räumlich. Damit einher geht ein Prinzip der Abgrenzung und der Nichtzuständigkeit. Und das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was es braucht, um ein Kind zu erziehen: ein ganzes Dorf. Dörfliche Strukturen leben von einer vielfältigen Vernetzung und bilden auf diese Weise ein transparentes Bezugssystem. Das vermittelt das Gefühl, auf differenzierte Weise wahrgenommen zu werden. Kommunikation mit dem Einzelnen ist damit auch Kommunikation mit dem System. Das heisst: Wer sich nützlich macht, wird eine breitere Anerkennung finden. Und wer sich daneben benimmt, kann nicht so mir nichts dir nichts in die Anonymität entwischen.
Schon den Römern war klar: divide et impera – teile und herrsche. Trennung, das ist das organisatorische Prinzip der öffentlichen Schule. Sie ist die wahre Privatschule – jede Klasse ist privat. Das schafft Unmengen von Refugien. Nicht nur für die Schüler.
Deshalb: Um ein Kind zu bilden braucht es ein ganzes Dorf, ein transparentes und präsentes System. Das ist mehr als ein punktuelles Zusammentreffen von Partikularinteressen. Viel mehr.